|

Die Luftangriffe am 6. November 1944 - Nekropole Gelsenkirchen-Schalke
Augenzeugenbericht von Joseph P. Krause:
Ginge es nicht um den Tod von Zivilpersonen bei der größten Tragödie Gelsenkirchens, als ganze Stadtteile unter Bombenteppichen zu gigantischen Trümmerbergen mutierten, als Menschen in grauenhaften Flammenmeeren mit markerschütternden Todesschreien zu namenlosem Sülz verschmorten, wäre der selbsternannte Zeitzeuge aus dem Internet zu belächeln, der fern vom entsetzlichen Bombenterror in bukolischer Idylle lebte, gleichwohl - sich zum Kronzeugen ernennend - als wichtigstes Ereignis vom Hörensagen bramabarsierte, sein Wohnhaus in Gelsenkirchen sei eingestürzt.
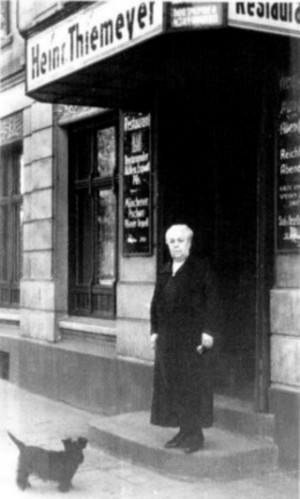 Abb.: Mutter Thiemeyer in Gelsenkirchen-Schalke
Ich hingegen gehöre zu den Zeitzeugen am Tatort der Zeitgeschichte, zu den Überlebenden des grauenvollsten, höllischsten Tages der Gelsenkirchener Chronik, des 6. November 1944, des Tages, an dem mein Geburtsort Schalke in flammendem Inferno unterging, als 738 RCAF-Bomber in zwei Angriffen - mittags und abends - tausende von Tonnen Spreng- und Brandbomben als "Bombenteppiche" über der "Stadt der tausend Feuer", die sie an jenem unheilvollen Tag wurde, ausklinkten und Kaskaden an Phosphor auskübelten, als Gelsenkirchen in einem riesigen Feuersturm verglühte, als die Schwester des Schalker Pfarrers Konrad Hengsbach, Pauline, zwischen herabgestürzten Balken bei lebendigem Leib verbrannte. Ich litt inmitten der Schreie der Sterbenden, des Blutes und der Fleischfetzen zerrissener Körper.
Und ich sah als Teil verzweifelter, vor Schmerz und Verzweiflung irrsinnig gewordener Menschen am Schalker Markt, wie das traditionelle Vereinslokal von Schalke 04, die Gaststätte der legendären "Mutter Thiemeyer", in einem gigantischen Feuerorkan zerbarst, während wir uns in den total überfüllten "Zuckerhut" zwängten, hineingetrieben von Feuersbrünsten und detonierenden Bomben.
Unser Wohnumfeld: Die Familien Dr. Hans Kassner (Augenarzt) und Paul Krause wohnten im Haus Kaiserstraße 71 (jetzt: Kurt-Schumacher-Straße). Im Haus rechts daneben wohnte die Familie des Ludwig ten Hompel, Amtsgerichtsrat und späterer Amtsgerichtsdirektor am Amtsgericht Gelsenkirchen. Bereits am 4. November 1944 war Schalke bei einem Bombenangriff in Mitleidenschaft gezogen worden. Aus einem brennenden Haus an der Grillostraße war mir dabei ein Funken in das rechte Auge, das sich davon entzündete, geraten.
|
 Abb.: Der 6. November 1944, Blick auf die Hölle am Boden. Das Foto ist um 14:03 Uhr aus einer Höhe von 17.500 ft gemacht worden, riesige Qualmwolken steigen aus dem Gelsenkirchener Stadtgebiet auf
"Schwarzer Montag", 6. November 1944, um 13:47 Uhr. Der "Drahtfunk", sich akustisch mit einem Sound wie Pferdegetrappel ankündigend, dessen Zentrale nach einem GE-Ondit in einem Bunker in Gelsenkirchen-Buer arbeitete, meldete sich nach meiner Erinnerung mit folgender Durchsage: "Starke feindliche Bomberverbände auf dem Anflug auf Gelsenkirchen."
Noch während dieser Meldung brach die entfesselte Hölle los. Wir flohen vor den Bombenteppichen, die unmittelbar mit dem Sirenengeheul der "akuten Luftgefahr" niedergingen, ins Freie. Bei dieser Luftwarnung drehte sich automatisch mein Magen um, und mich suchte stets eine schmerzhafte, ordinäre Diarrhöe heim. Ich wurde beim Hinuntersprinten aus dem 1. Obergeschoß unter Zersplittern von Fenstern und Türen von dem Luftdruck der ersten Bomben zusammen mit meiner 13jährigen Schwester Hildegard durch das geräumige Treppenhaus in das Parterre geschleudert. Im Bombenhagel und zwischen herumfliegenden Trümmerteilen und Granatsplittern der Flak gelangten wir in den öffentlichen Luftschutzkeller unter dem Feuerwehrmuseum an der Kaiserstraße, das zweite Haus links neben der Kaiserstraße 71. Dazwischen lag das Wohnhaus mit Praxis des Dr. med. Kirchmeyer. Meine Schwester Genoveva (19) war mit zwei Kindern in Panik zur Kirche St. Joseph gerannt und fand Zuflucht in der dortigen Krypta. Unter dem Feuerwehrmuseum erlitten wir das Nonplusultra eines Weltuntergangs. Zehntausende Spreng- und Brandbomben hagelten auf Schalke herab. Alle Versorgungsleitungen waren sofort unterbrochen. Kein Wasser. Kein Strom. Keine Funksignale oder Warnmeldungen. Jemand im Keller zündete eine Wachskerze an, die aber sofort durch Luftdruck erlosch. Orientierung boten allein die Streifen an den Wänden, die mit Leuchtfarbe gestrichen waren.
|
 Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Kaiserstrasse Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Kaiserstrasse
Die Sprengbomben waren zur Erhöhung des Horroreffekts unter der Zivilbevölkerung mit ratternden und pfeifenden Luftschrauben ausgestattet. Durch die perfide Akustik der niedergehenden Bombenteppiche ahnten wir im voraus, wann und mit welchem Gewicht eine Bombe in unserer Nähe einschlagen werde, und wir duckten uns instinktiv und kauerten auf dem Boden. Fortwährend preßten wir die Finger auf die Ohren und öffneten die Münder, damit der gewaltige Luftdruck nicht die Lungen und Trommelfelle zerriß. Der Keller schwankte und drückte seitlich zusammen. Von überall her tierische Schreie in Todesangst.
Kinder und Frauen weinten hysterisch, fluchten und beteten laut, warfen sich wimmernd auf den Boden, flehten vergeblich den unsichtbaren Gott um Erbarmen an. Wir waren Gefangene in der Hölle. Rauch. Hitze. Dann ein infernalisches Krachen und Knacken. Das Gebäude über uns war eingestürzt. Qualm kroch durch Mauerritzen und zerborstene Türen herein. Das zusammengebrochene Haus über uns brannte wie Zunder. Die Hitze wurde unerträglich. Durch einen Durchbruch im hinteren Teil des Kellers wankten rußgeschwärzte Gestalten herein, mit nassen Decken umhüllt. Einer der Flüchtigen heiserte mit tränenerstickter Stimme: "Die Schalker Straße existiert nicht mehr". Die mit meiner Mutter befreundete Schuhhändlerin Frau Ziegler mit ihrer Tochter (21 Jahre alt) war ein paar Meter von uns entfernt im Keller ihres Geschäftes an der Schalker Straße, Ecke Grillostraße, gegenüber dem früheren Schuhgeschäft Jampel, zusammen mit einer Tante der Ursula Rademacher (diese aus der Funkenburg, später Pfarrsekretärin bei Pfarrer Egon Röer an Hl. Dreifaltigkeit im Haverkamp) und dem Baby der Tante qualvoll verbrannt. Das war Dante's "Inferno" pur. Es herrschte Heulen und Zähneknirschen. Die geschundenen Menschen brüllten und schluchzten vor Verzweiflung und Todesfurcht. Grauen und Gruseln drang aus allen Fugen.
|
Nachdem die ersten Angriffswellen mit 738 Flugzeugen nach einer knappen Stunde, die uns wie eine Ewigkeit lähmte, abgeflaut war, wollten wir den Luftschutzkeller, über dem die Ruinen brannten, verlassen. Der Keller-Haupteingang (Treppenabgang) zur Kaiserstraße war von glühenden Trümmern und brennenden Balken halb verschüttet, der Mauerdurchbruch zur Schalker Straße als Fluchtweg durch ein unendliches Flammenmeer versperrt und unpassierbar. Meine Mutter Mathilde Krause erfaßte blitzschnell die Situation und organisierte aus den völlig verzweifelten, verstörten bis apathischen Frauen einen Rettungstrupp. Sie ergriff die noch nicht brennenden Teile der Bretter und Balken und drückte sie in fliegender Hast seitlich weg vom Kellereingang. Wir anderen schafften das schwelende Holz weiter nach hinten, um den Gang passierbar zu halten. Kleinere Trümmerteile warf meine Mutter in hohem Bogen durch Lücken im Balkendickicht nach oben in die gleißende Hitze des Feuers.
 Abb.: Aus dem Bunker-Luftschacht Kaiserstrasse Abb.: Aus dem Bunker-Luftschacht Kaiserstrasse
So schaffte sie einen schmalen Notausstieg, durch welchen wir Überlebenden uns mit versengten Kleidern und rußverschmiert zwängten und den Weg ins Freie bahnten, das heißt in einen tosenden Orkan aus Gluten und Rauch, während über und neben uns aus den Trümmern herausragende Balken krachend, brennend und glühend herunter stürzten. Glimmende Holzteile regneten herab. Über und in Schalke waberten Lohen unter unendlichem Funkenregen. Mütter schrieen ihre Verzweiflung mit den todbringenden Schwaden zum Himmel.
Dann unser lähmendes Entsetzen: Die Häuser an der Kaiserstraße waren als riesige Trümmerhaufen auf die Straße gekippt. In den glosenden Fensterhöhlen glotzte gräßliches Grauen. Aus unserem Wohnhaus, dessen Inneres durch die durchlöcherte Fassade bis auf die halbe Fahrbahn geschleudert war, schlugen lichterloh die Flammen. Andere Häuser brannten gleichfalls wie überdimensionierte Fackeln. Die Brandstätten erzeugten einen fürchterlichen Sog wie biblische Feuersäulen: "Die Erde war wüst und leer", sie war ganz mit Flammen bedeckt. Wir, ein Trupp irrsinnig Verzweifelter, klammerten uns aneinander und kletterten über das Chaos der brennenden Trümmer in Richtung Schalker Markt; denn in Gegenrichtung brannten die Kirchtürme von St. Joseph wie Strohfeuer und drohten, auf die Straße zu stürzen. Das Wohnhaus Kaiserstraße 71 (nach meiner Erinnerung im Eigentum der Fa. Küppersbusch, Herdfabrik in Gelsenkirchen, stehend) war durch eine Sprengbombe vernichtet worden. Diese durchschlug das Haus bis in den Keller, den wir bei dem besagten Angriff nicht benutzten. Er war auch nicht als Schutzraum ausgewiesen.
|
Unserem Wohnhaus gegenüber bestand das Haus des Kinderarztes (oder: HNO) Dr. Kunze nur noch aus einem riesigen Flammenturm, dessen Sog einer flüchtenden, alten Frau, die über die lodernden Scheite stolperte, den Hut vom Kopf riß. Sie wollte hinterher rennen und sich zur Rettung ihres Hutes in die Flammen stürzen. Ich - 12 Jahre alt - hielt sie instinktiv zurück und zerrte sie an der Hand von dem glühenden Feuersturm weg, und wir torkelten gemeinsam über die gleißenden Ruinen. Am Fenster im ersten Stock dieses Hauses oder nebenan flehte eine lichterloh brennende Frau mit erhobenen Armen wild gestikulierend und gellender Stimme in Todesangst vergeblich um Hilfe.
Der Schalker Markt, eingeschlossen von riesigen Feuerfackeln, war zu einem einzigen Tohuwabohu, von Nero-Churchill entzündet, verkommen. Über der Gaststätte "Bei Mutter Thiemeyer" (Schalke-04-Legende), der alten "Kaiserhalle", und im Haus nebenan warfen verzweifelte und völlig durchgeknallte Menschen - besessen von nacktem Wahnsinn - in der irrwitzigen Hoffnung, noch etwas retten zu können, ganze Möbelstücke aus den Fenstern der brennenden Zimmer auf den Gehsteig, wo sie zerschellten. Das Tapetengeschäft Ecke Schalker Markt / Schalker Straße brannte lichterloh wie Zunder, ebenso das Milchgeschäft Kruhöfer an der Ecke Kaiserstraße / Schalker Markt. Der Laden von Fritz Szepan (aus arisiertem Vermögen übernommen) und das frühere Tabakgeschäft des Ernst Kuzorra verglühten und zersprühten in gleißenden Lohen. Hinter vorgehaltener Hand wurde später Kuzorra's angeblicher Ausspruch verbreitet: "Jetzt kann Hitler mich am Arsch lecken!"
 Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Königsbergerstrasse Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Königsbergerstrasse
Die Gewerkenstraße bestand nur noch aus riesigen, lichterloh brennenden oder glühenden Trümmerhalden, die von allen Seiten kreuz und quer übereinander gestürzt waren: Ein apokalyptisches Gebirge unter der tödlichen Sonne Satans. Immer wieder detonierten Blindgänger. Die Luft war grenzenlos mit wirbelndem Funkenregen zerstrahlt. Die Industrieanlagen nördlich und westlich des Schalker Markts mutierten zum Höllenfeuer Luzifers. Alles brannte und knisterte und heulte, Menschen kreischten, zitterten verbittert und verzweifelt. Wir fanden Notaufnahme im völlig überfüllten, mit blutigen und angekokelten, nach konzentrierten Schweißschwaden miefenden Menschen vollgestopften Spitzbunker ("Schalker Zuckerhut") mitten auf dem Schalker Markt, der von Bombentrichtern zerwühlt und mit zahllosen, qualmenden Trümmern übersät war.
Meine Mutter begab sich sofort an die Pumpenaggregate, um wegen des Stromausfalls per Handbetrieb an der Frischluftversorgung für uns, die von der Außenwelt hermetisch abgekapselten Insassen, mitzuarbeiten. Drinnen war es stickig und überhitzt. Wir saßen auf Böden und Treppen, zusammengepfercht wie Ölsardinen. Die Briten steigerten das Grauen durch eine weitere Angriffswelle. So erlebten und überlebten wir den zweiten Großangriff abends am selben Tag, dem 6. November 1944, um 19:25 Uhr. Der Tod kehrte zurück. Schalke wurde zur Nekropole, zum Blutacker, zum Hochofen für Menschenfleisch. Der Gottseibeiuns griff nochmals gierig nach uns Überlebenden der Katastrophe. Auf das erlittene Entsetzen wurde wiederum grausamste Vernichtung angedockt und aufgestockt. Der "Zuckerhut" wurde bei dem abendlichen Alarm nach meiner Erinnerung zweimal von Sprengbomben getroffen. Unser Elend wurde vervielfacht. Wir drehten durch. Der "Zuckerhut" schwankte pausenlos, so daß wir dachten, er kippt um. Wieder schreiende und verzweifelte Menschen, ein Haufen Wahnsinniger in Todesangst, innerhalb weniger Stunden erneut gebeutelt und drangsaliert, laut plärrende oder wimmernde Kinder mit voll geschissenen Hosen ohne Nahrung und Wasser, ohne Elektrizität, Erwachsene, die wie Kleinkinder in die Leibwäsche urinierten. Das nicht mehr zu überbietende Grauen war über Schalke hereingebrochen. Es roch nach verbranntem Fleisch und Unrat.
Noch heute, nach über mehr als 60 Jahren, weine ich als alter Mann, wenn der Kalender den 6. November anzeigt. Wir waren durch den entflammten und enthemmten Horror und Terror getrieben worden, hatten die Eruptionen der Hölle überlebt, Vulkane des Phosphors, Attacken von Brandbeschleunigern, die gewaltigen Druckwellen der Luftminen, das Tosen von tausend Feuern. Am späten Abend war draußen tückische Ruhe eingekehrt, und die Ordnungskräfte ließen einzelne Gruppen der Bunkerinsassen nacheinander über eine noch intakte Nottreppe zum Eingangsbereich vor, damit die Leute an die "frische Luft" kamen, die allerdings aus penetrantem Brandgestank bestand, aus dem Mief verbrannten Fleisches und Unrats. Ringsherum waren nur Trümmer und Feuerwalzen zu sehen. Manche Frauen standen stumm vor grenzenlosem Leid, sie schluchzten, andere drehten durch und röhrten verzweifelt ihren Schmerz gegen den brutalen, erbarmungslosen, blutigen Himmel.
|
 Abb.: Luitpoldstrasse an der Georgskirche Abb.: Luitpoldstrasse an der Georgskirche
Die Leute brüllten vor Entsetzen, fielen sich weinend in die Arme: Schalke war ausradiert, der Stadtteil zerschlagen, in den Kellern verbrannten stinkend die Leichen oder sterbend Begrabene wie Pauline Hengsbach, die - eingeklemmt zwischen herabgestürzten Balken - im Keller des Pfarrhauses St. Joseph an der Grillostraße 62, Ecke Anton-Hechenberger-Straße (jetzt: Königsberger Straße ) bei lebendigem Leib eingeäschert wurde, im Krematorium haßerfüllter Feinde, Schwester des Schalker Pfarrers Konrad Hengsbach, Tante des Franz Hengsbach, später erster Bischof des Bistums Essen. Konrad Hengsbach wurde am Ohr von Phosphor übergossen. Es regnete Feuer vom Himmel - wie in Ägypten des Alten Testaments. Konrad Hengsbach trug mir später auf, den Untergang Schalkes schriftlich festzuhalten. Im Phosphor-Sprüh wurden Menschen bei 1300 Grad Celsius gekocht und verschmort, lebendig gebraten. Der unangenehme Gestank von Phosphor verursachte Brechreiz. Wenn ich heute Karbid oder Knoblauch rieche, tauchen in mir die Bilder der Phosphor-Verbrannten wieder auf.
Einer der Überlebenden im Keller des Pfarrhauses war Heinrich Rettler, später Rektor der Volksschule an der Caubstraße in Schalke-Nord, die ich als Notbehelf 1946 frequentierte. Rettler war übrigens der Meinung, ich sei der geborene Chronist. Viele hatten am 6. November 1944 ihr Hab und Gut verloren, waren obdachlos. Gott hatte sich von Schalke abgewandt. Unsere Schwester Genoveva hielten wir für tot. Irgendwann stieß sie mit den beiden Geschwistern verstört zu uns. Sie hatte sich aus der Krypta der brennenden Schalker Pfarrkirche St. Joseph gerettet. "Entkam den Flammen wie durch ein Wunder" titelten die "Ruhr-Nachrichten" in einem Rückblick am 15. Oktober 1977.
|
Von unserem Vater Paul Krause, der "auf Consol" verschüttet war, hörten wir erst Tage später, daß er lebte. Ich meine mich zu erinnern - allerdings unter Vorbehalt - daß er mit einigen Kumpels durch den Schacht "Oberschuir" in der Feldmark ans Tageslicht geholt wurde. Später fanden meine Mutter und Frau Kassner (Ehefrau des Dr. med. Hans Kassner) heraus, daß das Wohnhaus des Oberstudiendirektors Schönhauer vom Adolf-Hitler-Gymnasium trotz eines Treffers durch eine Brandbombe eine provisorische Unterkunft bot. So hausten wir vorübergehend dort. Noch 3 oder 4 Tage nach den beiden Großangriffen am 6. November 1944 hatten Rettungstrupps aus dem Keller der zusammengestürzten Drogerie Schmitz (Ecke Kaiserstraße und Grillostraße, zwei Häuser links vom Feuerwehrmuseum) eine Frau herausgeholt. Sie lag vor dem Haus auf Trümmern und war total schwarz, verbrannt, verkohlt, verrußt, das Gesicht unkenntlich: Aber ich merkte, als ich mich über sie beugte, daß sie - bestialisch nach verbranntem Fleisch und Kot stinkend - noch schwach röchelte. Wo Straßen asphaltiert waren, konnte man nicht gehen, weil der Teer durch die Hitze der Feuersbrünste zu einer zähen Masse aufgequollen war.
In der Turnhalle des Gymnasiums (Eingang Schalker Straße), die nur teilweise zerstört war, wurden die Leichen und Leichenteile gesammelt, verbrannt, geschrumpft, zerfetzt. 518 Bombenopfer wurden identifiziert. Später errechneten Statistiker für diesen Tag des Entsetzens auf dem Kriegsschauplatz Gelsenkirchen den Abwurf von 6460 Sprengbomben und 167 131 Brandbomben. 17880 Häuser wurden in Schutt und Asche gebombt.
Zur Bergung der Toten wurden auch gefangene 'Fremdarbeiter' eingesetzt. In den Trümmern der Fa. Pleiss, Bäckereibedarf, Ecke Martin-Faust-Straße und Anton-Hechenberger-Straße (jetzt: Magdeburger Straße und Königsberger Straße), war zwischen den Trümmern des Warenlagers Zucker verschmort. Ich sah, wie die jungen, unrasierten, total verdreckten Zwangsarbeiter verzweifelt Stücke der harten Masse losschlugen und gierig hinunterschlangen, um Zusatznahrung zu haben. Dies geschah unter Lebensgefahr; denn Plünderer wurden standrechtlich erschossen.
Wenig später wurde meine Mutter fälschlich bei den NS-Behörden unter der Anschuldigung des Plünderns denunziert. Ihre handschriftlichen Niederschriften, die sie im Gewahrsam der Gestapo fertigte, besitze ich noch heute. Es stellte sich heraus, daß sich die angeblich von meiner Mutter geplünderten Kleidungsstücke bei einer aus Schalke evakuierten Familie in Ostwestfalen befanden. Von unserem Wohnhaus Kaiserstraße 71 blieb lediglich ein Teil der Fassade stehen. Die gewaltige Öffnung in der Mitte der 1. Etage war zuvor ein Erker, in welchem bis zum Bombeneinschlag ein riesiges Aquarium stand, das mich täglich mit seiner Unterwasserwelt fasziniert hatte. Den einzigen Rest von Wert aus den Trümmern barg ich in Handarbeit 1946. Unsere Waschmaschine (Holzbottich mit Wassermotor) grub ich mit bloßen Händen aus einer Ecke der ehemaligen Waschküche, wozu ich die Trümmer beiseite schaffen mußte. Wir Kinder waren in der Taxierung der Bomben und britischen Flugzeugtypen wahre Experten und konnten Flugzeuge beim Anflug an ihren Motorgeräuschen identifizieren, was sehr leicht bei den "Spitfire" gelang. So schätzte ich nach der Tiefe und Größe des Kraters "unsere" Bombe auf 20-Zentner. Sie war in die Waschküche geschlagen und der Luftdruck nach oben entwichen, so daß das Gerät - bedeckt von Ziegelsteinen und Mörtel - nicht gänzlich zerstört und vom Bombentrichter aus relativ schnell frei zu räumen war. Zwar war alles trostlos demoliert, aber es fand sich am früheren Alten Markt in Gelsenkirchen ein älterer Handwerker in einem provisorischen Schuppen, der die Dauben des Holzbottichs erneuerte (die metallenen Reifen hatte ich gleichfalls gerettet) und den Wassermotor reparierte, reinigte und ölte.
Epilog zum Schalker Lokalkolorit: Vor dem 6. November 1944 war für solche Reparaturen (Löten und Schweißen von Haushaltsgeräten, Töpfen, Eimern u.a.) "Philipp Heinrich" als renommierter Betrieb zuständig, Schalker Straße, Ecke Grillostraße, schräg gegenüber dem Schuhgeschäft des jüdischen Kaufmanns Jampel, wo ich mit meiner Mutter die "Reichskristallnacht" 1938 hautnah erlebte, alle Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört am 6. November 1944.
Autor: Joseph P. Krause, Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung.

|
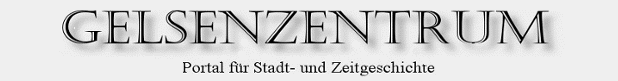
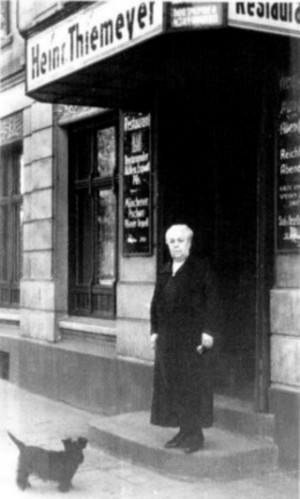

 Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Kaiserstrasse
Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Kaiserstrasse Abb.: Aus dem Bunker-Luftschacht Kaiserstrasse
Abb.: Aus dem Bunker-Luftschacht Kaiserstrasse Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Königsbergerstrasse
Abb.: Liboriusstrasse / Ecke Königsbergerstrasse Abb.: Luitpoldstrasse an der Georgskirche
Abb.: Luitpoldstrasse an der Georgskirche